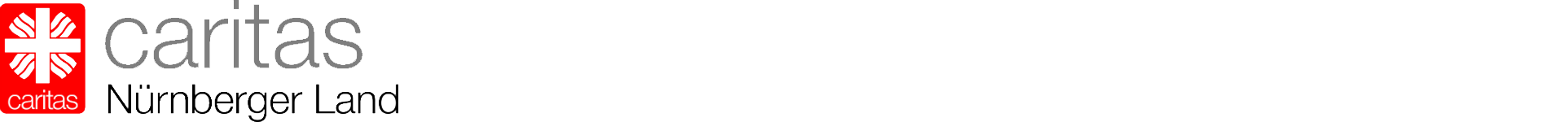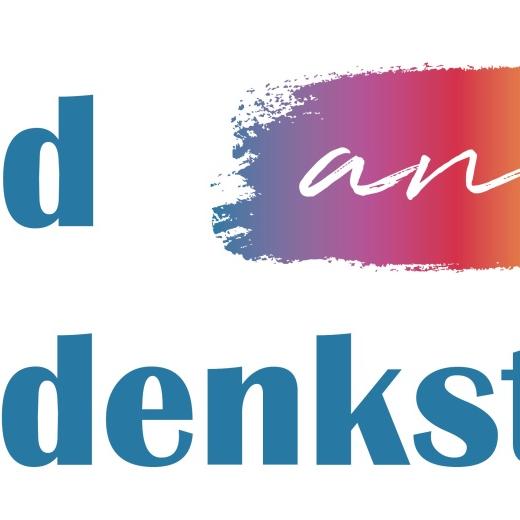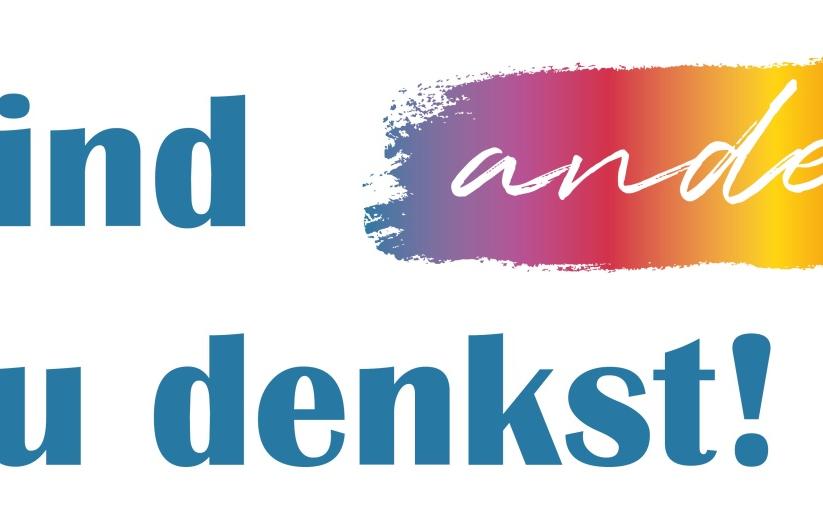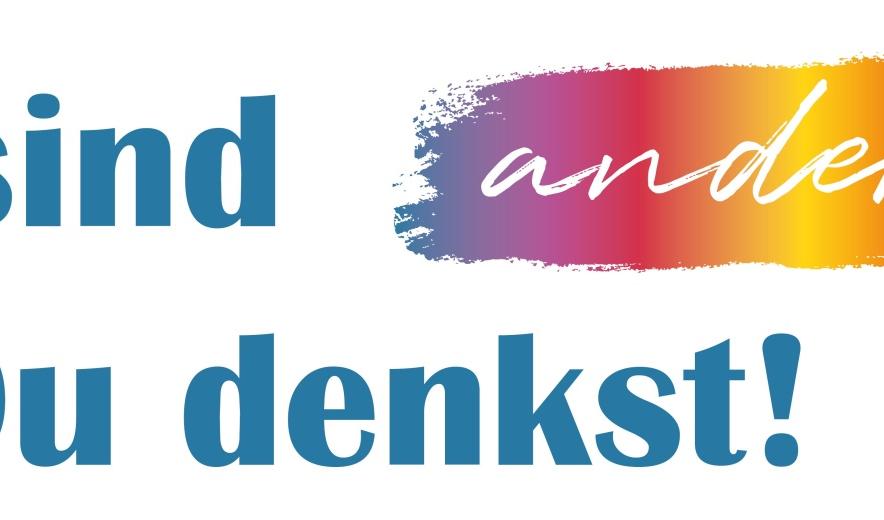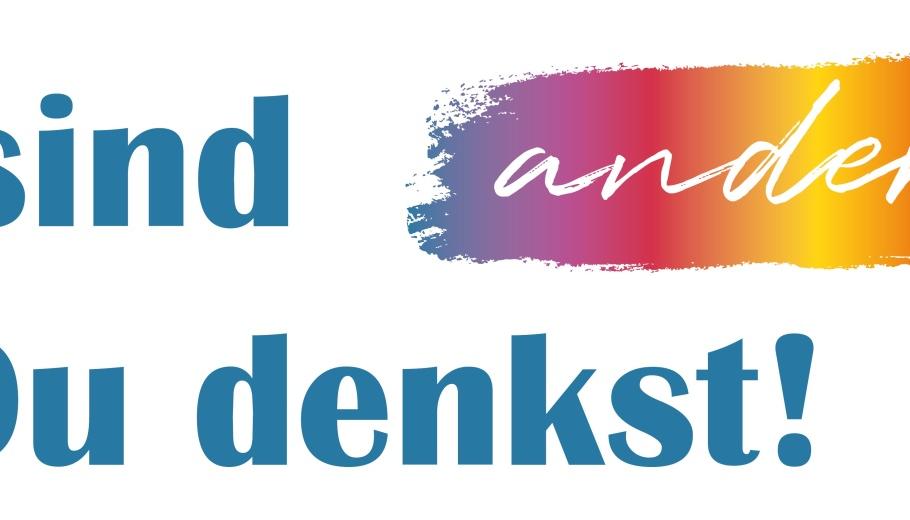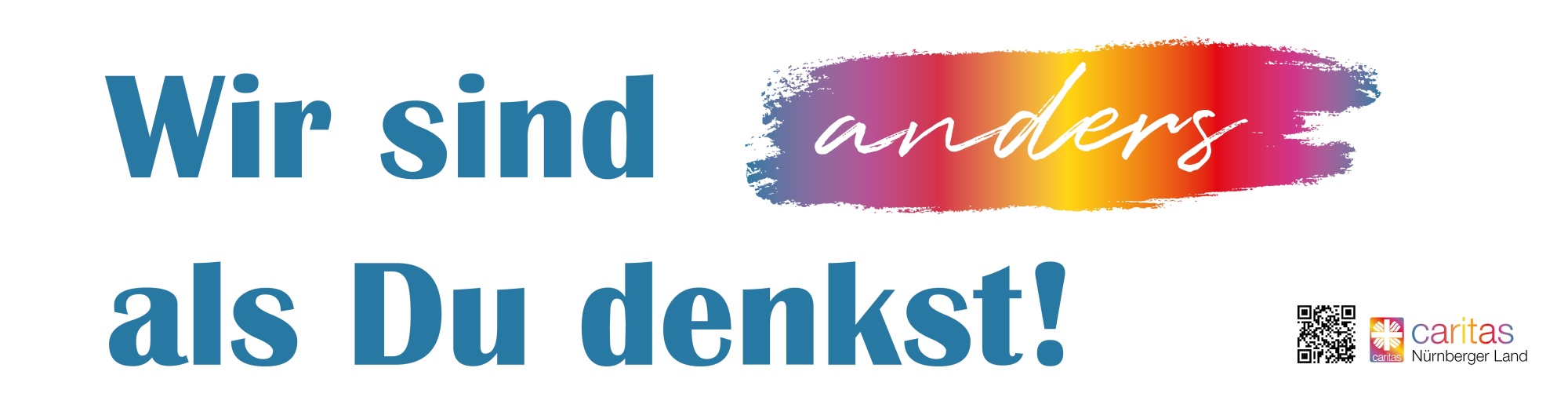Opfern eine Stimme geben

Opfer der Digitalisierung
Sie macht Menschen zu Verlierern, die zuvor keine Hilfe brauchten. Darauf muss die Soziale Arbeit reagieren.
Was nicht digital ist, ist nicht real.
Informationen, die nicht per E-Mail gegeben oder als PDF verschickt werden, gelten als nicht gegeben. Mündliche Infos werden häufig mit dem Satz versehen: „Könnten Sie mir das noch kurz als E-Mail schreiben, dann bearbeite ich das.“ Schön gemalte Plakate gelten mittlerweile als völlig unprofessionell, wenn sie nicht als vierfarbige druckfähige Datei kommen.
Die Digitalisierung hat unbestrittene Vorteile. Pflegedokumentation oder Erfassung von Leistungen der Eingliederungs- und Jugendhilfe lassen sich digital besser und schneller verarbeiten, indem Mitarbeitende etwa Textbausteine in die passenden Textpassagen kopieren. Außerdem lassen sich darauf automatisiert Abrechnung, Leistungsnachweis und die nötigen QM-Unterlagen einfach aufsetzen. Die Fehlerquote bei diesen zum Kernprozess nachgelagerten Verfahren sinkt deutlich und die Effizienz steigt.
Doch die digitalen Prozesse haben auch eine Kehrseite. Zwischenmenschliche Interaktionen versinken damit auf anderen Ebenen, weil sie zunächst ineffizient und widerständig wirken. Im digital Un- oder Unterbewussten verlieren sie so ihren Realitätsanspruch.
Was nicht digital ist, ist nicht mehr real. Mit der digitalen Uniformität des Informationsformats und seiner zunehmenden Fülle geht jedoch sein Aufmerksamkeits- und Gestaltcharakter verloren. Informationen müssen immer massiver und aufmerksamkeitsheischender und damit auch bedrohlicher, lusterweckender und skandalöser werden, um aus der Menge anderer Infos hervorzustechen. In den Medien lässt sich das gut beobachten. Die an sich befriedigende Qualität normaler zwischenmenschlicher Informationen gerät dabei zunehmend aus dem Blick.
Auch die Digitalisierung schließt Menschen aus.
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verstärkt diese Entwicklung. Gefordert ist der digitale Zugang zu allen wesentlichen amtlichen Vorgängen. Parallel dazu werden die Prozesse von Bankenwesen über den Einkauf bis zum Theaterbesuch durchdigitalisiert. Zusammen ersetzen diese digitalen Prozesse die altbekannten Formen zwischenmenschlicher Interaktionen vollständig.
Diese Veränderung führt keineswegs zur Beschleunigung der primären Interaktionen. Ganz im Gegenteil: Diese werden häufig für die Menschen komplizierter, weil noch das letzte Zeichen im Passwort korrekt sein muss. Ein Vorteil ergibt sich häufig allein in den nachgelagerten Prozessen der Informationsweiterverarbeitung, die damit beschleunigt werden könnten.
Digitale Zugangsprozesse schließen aber Menschengruppen aus, die damit Schwierigkeiten haben. Alte Menschen und Menschen mit Behinderungen kommen vielfach mit den digitalen Anforderungen nicht zurecht und sind dann nicht mehr in der Lage, ihre Geschäfte selbständig zu erledigen. Sie sind auf Hilfspersonen oder Betreuerinnen und Betreuer angewiesen. Das geht mit einer Entwürdigung der eigenen Person einher oder führt zum sozialen Rückzug dieser Menschen aus bestimmten Lebensbereichen.
Die Hoffnung, dass dieses Ausgrenzungsphänomen vorübergehender Natur ist, weil die Menschen aussterben werden, die nicht mit digitalen Medien aufgewachsen sind, ist eine massive Menschenrechtsverletzung. Zugleich lässt die exponentielle Beschleunigung des Technologiefortschritts diese Hoffnung als blanke Illusion erscheinen. Schon jetzt ist klar, dass auch künftige, mit der digitalen Welt besser vertraute Generationen von der technischen Entwicklung in der Zukunft abgehängt werden. Gerechtigkeit darf nie nur für die Gegenwart allein oder erst in Zukunft gelten. Sie muss für heute, gestern und morgen gleichermaßen gelten. Verraten wir sie, wie können wir sie dann von anderen erwarten?
Steigerung menschlicher Ohnmacht durch die Digitalisierung
Nicht nur findet ohne Google-Maps niemand mehr seinen Weg oder den richtigen Bahnanschluss. Auch die Sitzplatzreservierung im Zug, die Preisauszeichnung im Supermarkt oder die Schaltung der Ampelanlage sind ohne digitale Steuerung nicht möglich. Das gilt für die Geschwindigkeitssteuerung des Zahnarztbohrers, die Steuerelektronik des Autos, die Auswertung der MRT-Daten, die Leistung der Heizungsanlage, das Öffnen der Jalousien im Smart-House. Digitalisierung macht vieles leichter und bequemer, aber die Menschen zugleich immer lebensunfähiger und ohnmächtiger, wenn die digitalen Hilfsmöglichkeiten ausfallen. Die falsche Bewegung einer Baggerschaufel hat schon zu oft ganze Firmen komplett ins digitale Aus befördert, mit allen Konsequenzen.
Es scheint eine proportionale Beziehung zwischen zunehmender und besserer Digitalisierung und menschlicher Verletzlichkeit zu geben. Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung nehmen auch menschliche Vulnerabilität und Ohnmacht zu. Damit offenbart sie auch ihre Schattenseiten: Sie grenzt Teile der Realität und Menschengruppen aus. Sie macht Menschen ohnmächtig.
Aufgaben für die Soziale Arbeit
Gerade wir in der Sozialen Arbeit müssen deshalb die Verletzlichkeit des Menschen im Blick behalten. Menschliche Freiheit ist nicht nur Offenheit für neue Möglichkeiten und Freiheit von Unterdrückung. Sie ist auch verletzlich. Wir müssen Menschen in ihrer Verletzlichkeit beschützen und dürfen sie nicht allein lassen. Menschen dürfen nicht zum Opfer werden.
Untersuchungen im Gesundheitswesen zeigen, dass Patientinnen und Patienten zwischen Rechenschaftslegung und Vertrauenswürdigkeit klar unterscheiden. Für sie bleibt stets nachvollziehbar, dass Transparenzstandards oder eine verbesserte Dokumentation Folgen externer Anreize sind. Der Kern des Vertrauens etwa in die Kompetenz der behandelnden Ärztin liegt jedoch woanders. Es gründet auf ihrer Bereitschaft, sich dem Einzelnen individuell und mit wachem Interesse aus ihrer Professionalität heraus zuzuwenden. Erst die Beziehung zwischen Behandelnden und Patientin oder Patient ist die Grundlage der Genesung.
Institutionen haben die Tendenz, sich nach innen möglichst zu homogenisieren und dabei nach außen abzugrenzen. Sie drängen damit ihren Daseinsgrund nach außen, wodurch sie leblos werden. Demnach steht auch das Gesundheits- und Sozialwesen in der Gefahr jeder Institution, ihren Daseinsgrund, das Heilwerden des kranken Menschen, die Wohlfahrt oder Selbstwirksamkeit des hilfesuchenden Menschen auszugrenzen. Bei ihren Qualitätssicherungsprozessen konzentrieren sie sich folglich im Wesentlichen auf die Beschreibung des eigenen Tuns und den Erfolg der eigenen Organisation. Die Menschen, für die sie eigentlich da sind, werden an den Rand gedrängt.
Alle diese Optionen weisen im Umgang mit den Schattenseiten der Digitalisierung in eine ähnliche Richtung: Die Aufmerksamkeit der in Gesundheitswesen und Sozialer Arbeit handelnden Menschen gehört nicht nur auf die Perfektionierung von digitalen Prozessen gerichtet, sondern auf eine individuelle vertrauensvolle Beziehung. Den individuellen Prozessen von Menschen an den Rändern der Institution muss mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden, auch wenn sie die eigenen Strukturen herausfordern und zum Erliegen zu bringen drohen. Die handelnden Menschen in der Sozialen Arbeit müssen ein kritisches Verhältnis zur Digitalisierung gewinnen. Wir müssen an ihr vorbei ratsuchende und vereinsamte Menschen in den Blick bekommen und diese unterstützen. Darin liegen Lebendigkeit und Sinn für die Soziale Arbeit, die Gesellschaft und ihren Zusammenhalt.
Nicht mehr Digitalisierung ist die Antwort auf die mit ihr einhergehenden Probleme, sondern zusätzliche Sensibilität für ihre Opfer.
In diesem Zusammenhang verweisen wir gerne auch auf den Link bei der Wohlfahrt Intern: www.wohlfahrtintern.de
https://www.wohlfahrtintern.de/navi-header/heft/newsdetails/article/opfern-eine-stimme-geben
Text: Dr. Michael Groß